Adhäsion erklärt für industrielle Kontexte (und darüber hinaus)
Adhäsion ist die grundlegende Kraft, die Materialien miteinander verbindet – vom Lack eines Autos bis zum Klebstoff in einem Smartphone. Technisch gesehen beschreibt sie die Anziehungskräfte zwischen verschiedenen Materialien an ihrer Grenzfläche, unabhängig davon, ob diese Kräfte mechanischer, chemischer oder physikalischer Natur sind. Einfacher ausgedrückt bestimmt die Adhäsion, wie gut ein Material an einem anderen „haftet“ – eine wesentliche Eigenschaft für fast alle Fertigungs- und Konstruktionsprozesse.
Aufgrund ihrer Bedeutung ist Adhäsion nicht nur ein praktisches Anliegen, sondern auch ein wichtiger Bereich der Forschung und technologischen Innovation. Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten kontinuierlich daran, die Mechanismen zu verstehen und zu kontrollieren, die die Adhäsion bestimmen, und entwickeln neue Materialien, Oberflächenbehandlungen und Verifizierungsmethoden, um den immer höheren industriellen Standards gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang sind moderne Oberflächenvorbehandlungstechnologien wie die Plasmaaktivierung zu wichtigen Werkzeugen geworden, um die Adhäsion auf schwierigen Materialien zu verbessern und so die Lücke zwischen Theorie und industrieller Anwendung zu schließen.
Wie Adhäsion funktioniert: Die Wissenschaft hinter starken Verbindungen
Adhäsion beschreibt die Gesamtheit der physikalischen und chemischen Wechselwirkungen, die dazu führen, dass zwei unterschiedliche Materialien an ihrer Grenzfläche zusammenhalten. Auf mikroskopischer Ebene wirken mehrere Mechanismen gleichzeitig. Van-der-Waals-Kräfte erzeugen schwache, aber weit verbreitete Anziehungskräfte zwischen Molekülen und bilden die Grundlage für die meisten Haftverbindungen. In vielen industriellen Prozessen sorgt die chemische Bindung – wie kovalente, ionische oder Wasserstoffbrückenbindungen – für stärkere und spezifischere Verbindungen zwischen Oberflächen. Mechanische Verriegelung tritt auf, wenn ein flüssiger Klebstoff oder eine Beschichtung in Unebenheiten der Oberfläche eindringt und aushärtet, wodurch er sich physikalisch am Untergrund verankert. In bestimmten Systemen tragen auch elektrostatische Effekte dazu bei, da sich entgegengesetzt geladene Oberflächen über die Grenzfläche hinweg anziehen.
Für eine effektive Verklebung hängen diese Mechanismen stark von der Oberflächenenergie des Substrats und seiner Fähigkeit ab, von einem Klebstoff, einer Beschichtung oder einer Tinte benetzt zu werden. Auf Oberflächen mit hoher Energie (wie Metallen oder Glas) können sich Flüssigkeiten leicht ausbreiten, was einen engen molekularen Kontakt und eine stärkere Haftung fördert. Niedrigenergetische Materialien (wie Polyethylen oder Polypropylen) neigen dazu, Flüssigkeiten abzuweisen, sodass eine Oberflächenbehandlung erforderlich ist, um die Benetzbarkeit zu verbessern. Temperatur, Oberflächenrauheit und Materialverträglichkeit beeinflussen ebenfalls, wie gut sich die Haftung entwickelt. Beispielsweise kann eine erhöhte Temperatur die Molekülbeweglichkeit verbessern und so eine bessere Diffusion und chemische Bindung ermöglichen, während eine übermäßige Rauheit die tatsächliche Kontaktfläche verringern kann, wenn Vertiefungen ungefüllt bleiben.
Es muss auch klar zwischen Adhäsion und Kohäsion unterschieden werden: Adhäsion bezieht sich auf die Anziehungskraft zwischen verschiedenen Materialien, während Kohäsion die innere Festigkeit innerhalb eines Materials oder einer Klebeschicht beschreibt. Beide sind entscheidend – eine starke Adhäsion ohne ausreichende Kohäsion führt zu einem inneren Versagen und umgekehrt.
In der Praxis bestimmt die Haftung den Erfolg unzähliger industrieller Anwendungen – vom Lackieren und Kleben bis hin zum Drucken, Beschichten und Versiegeln. Das Verständnis des Kräftegleichgewichts und der Oberflächeneigenschaften, die der Haftung zugrunde liegen, ermöglicht es Ingenieuren, Prozesse zu optimieren, geeignete Materialien auszuwählen und eine langfristige Zuverlässigkeit der Verbindung sicherzustellen.
Warum Haftung in der Fertigung wichtig ist

Die Adhäsion spielt in zahlreichen Industriezweigen eine entscheidende Rolle, in denen zuverlässige Klebe-, Beschichtungs-, Dichtungs- oder Druckverfahren für die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit der Produkte von grundlegender Bedeutung sind.
In der Automobilindustrie beispielsweise müssen Klebeverbindungen Vibrationen, Temperaturwechseln und Materialkombinationen (z. B. Kunststoff-Metall-Verbindungen) standhalten und während der gesamten Lebensdauer eines Fahrzeugs ihre Integrität bewahren. In der Elektronikfertigung ist eine hochpräzise Verklebung für zuverlässige Leiterplatten, Displaybeschichtungen und Mikrobaugruppen unerlässlich. In der Medizintechnik ist die sichere Verklebung und Abdichtung von Komponenten (wie Implantaten, Kathetern oder Instrumenten) für die Sicherheit und Biokompatibilität von entscheidender Bedeutung. Die Verpackungsindustrie verlangt eine gleichbleibende Klebe- und Druckleistung auch auf energiearmen Materialien wie Polypropylen oder recycelten Folien, während die Textilherstellung und die breitere Transportindustrie (Schiene, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau) zunehmend auf Materialkombinationen und Oberflächenbehandlungen angewiesen sind, um die Haftfestigkeit zu erhalten, das Gewicht zu reduzieren und die Oberflächenfunktionalität zu verbessern.
Bei Plasmatreat sind unsere Branchenlösungen für Kunststoffe, Metalle, Glas, Karton, Textilien und Verbundwerkstoffe in den Bereichen Automobil, Elektronik, Verpackung, Biowissenschaften und Transport einsetzbar.
In all diesen Kontexten ist die grundlegende Herausforderung dieselbe: Es gilt, unter anspruchsvollen Umgebungs- oder Betriebsbedingungen eine ausreichende Haftwirkung zwischen Oberflächen zu erzielen und aufrechtzuerhalten, die sich unter Umständen stark voneinander unterscheiden. Daher hat es für Entscheidungsträger in der Fertigung höchste Priorität, sicherzustellen, dass die Haftung nicht nur zum Zeitpunkt der Verklebung, sondern über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg robust ist.
Typische Ursachen für schlechte Haftung

In der industriellen Fertigung gehören Haftungsfehler zu den häufigsten und kostspieligsten Qualitätsproblemen. Probleme wie Delamination, Abblättern oder Ablösung können auftreten, wenn Beschichtungen, Klebstoffe oder Dichtstoffe keine stabile Verbindung mit dem Untergrund eingehen. Ein typisches Beispiel ist das Abblättern von Farbe von einer Kunststoffoberfläche oder das Lösen einer Klebeverbindung unter mechanischer oder thermischer Belastung. Die Ursache liegt oft in den Oberflächeneigenschaften des Materials – insbesondere bei Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder Polytetrafluorethylen (PTFE). Diese Polymere sind chemisch inert und unpolar, was bedeutet, dass Klebstoffe oder Beschichtungen ihre Oberflächen nicht leicht benetzen oder sich daran verankern können. Weitere schwierige Materialien sind bestimmte Fluorpolymere, Silikone und Verbundlaminate mit inkompatiblen Oberflächenschichten.
Allerdings sind die Materialeigenschaften nicht das einzige Problem. Unzureichende Reinigung, Rückstände von Trennmitteln oder oxidierte Schichten können zu schwachen Grenzschichten führen, die einen intimen Kontakt zwischen Klebstoff und Untergrund verhindern. Ebenso können eine falsche Materialkombination oder die Verwendung eines Klebstoffs, der mit der Chemie des Substrats nicht kompatibel ist, zu einem vorzeitigen Versagen der Verbindung führen. Selbst wenn der richtige Klebstoff verwendet wird, kann eine fehlende oder unzureichende Oberflächenaktivierung – beispielsweise das Überspringen der Vorbehandlung vor dem Verkleben oder Beschichten – die Haftfestigkeit drastisch verringern.
Um diese Probleme zu lösen, setzen Ingenieure auf eine Kombination aus Oberflächenvorbehandlung, optimierter Materialauswahl und präziser Klebstoffanpassung. Vorbehandlungsverfahren wie Plasmaaktivierung, Koronaentladung oder Flammbehandlung können die Oberflächenenergie erhöhen und starke, dauerhafte Verbindungen auf zuvor nicht benetzbaren Materialien ermöglichen. Die Auswahl von Klebstoffen, die für bestimmte Substratchemien formuliert sind, und die Einhaltung strenger Reinigungsprotokolle minimieren das Risiko eines Haftungsversagens zusätzlich. Diese Methoden bilden die Grundlage für den nächsten Schritt: Wie Oberflächenmodifikation und Vorbehandlung die Haftungsleistung verbessern.
Oberflächenreinigung und Aktivierung: Wie die Vorbehandlung die Haftung verbessert

Eine starke, dauerhafte Verbindung beginnt lange vor dem Auftragen von Klebstoff, Beschichtung oder Dichtungsmittel – sie beginnt mit einer sauberen und ordnungsgemäß aktivierten Oberfläche. Selbst mikroskopisch kleine Spuren von Öl, Staub, Trennmitteln oder Oxidationsschichten können den für eine zuverlässige Haftung erforderlichen engen Kontakt verhindern. Verunreinigungen wirken wie schwache Grenzschichten, die die molekulare Wechselwirkung zwischen den Materialien unterbrechen und zu Haftungsfehlern wie Abblättern, Blasenbildung oder Delaminierung führen. Daher ist eine gründliche Reinigung der wesentliche erste Schritt bei jedem Klebe-, Beschichtungs- oder Dichtungsprozess. Sobald die Oberfläche frei von Verunreinigungen ist, verbessert die Aktivierung ihre chemische und physikalische Bereitschaft für die Haftung zusätzlich.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Aktivierung liegt in der Erhöhung der Oberflächenenergie und der Verbesserung des Benetzungsverhaltens. Eine hochenergetische Oberfläche ermöglicht es Flüssigkeiten – wie Farben, Klebstoffen oder Dichtungsmassen – sich gleichmäßig zu verteilen, wodurch die molekulare Kontaktfläche maximiert und stärkere Grenzflächenkräfte gefördert werden. Im Gegensatz dazu neigen unbehandelte Oberflächen, insbesondere Kunststoffe mit niedriger Energie, dazu, Flüssigkeiten abzuweisen, was zu einer schlechten Benetzung und einer unzuverlässigen Haftung führt.
Es gibt verschiedene Technologien, um die Oberflächenenergie und Sauberkeit zu verändern. Die Koronabehandlung beispielsweise wird häufig für Kunststoffe und Folien eingesetzt. Dabei wird eine elektrische Hochspannungsentladung erzeugt, die die Oberfläche oxidiert und polare funktionelle Gruppen einführt. Ihre Wirksamkeit ist jedoch in der Regel auf nichtleitende Materialien beschränkt. Die Plasmabehandlung bietet dagegen eine weitaus größere Flexibilität – sie kann auf Kunststoffe, Metalle, Glas, Verbundwerkstoffe und sogar Textilien angewendet werden. Laut dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Automatisierung entfernen Plasmaprozesse nicht nur organische Rückstände, sondern aktivieren auch chemisch die obersten Molekülschichten einer Oberfläche, wodurch sowohl eine mikrofeine Reinigung als auch eine Funktionalisierung in einem Schritt erreicht werden.
Zu den besonderen Vorteilen von Plasma gehören der trockene, umweltfreundliche Betrieb (keine Lösungsmittel oder Chemikalien), die präzise Steuerung und die Eignung für die Inline-Integration in automatisierte Produktionssysteme. Es kann kleine, komplexe oder empfindliche Komponenten selektiv behandeln, ohne das Schüttgut zu beeinträchtigen. Durch die gleichzeitige Reinigung und Aktivierung erhöht Plasma die Oberflächenenergie erheblich, verbessert die Benetzbarkeit und schafft optimale Bedingungen für eine langfristige Haftungszuverlässigkeit – damit ist es eine der vielseitigsten und effektivsten Vorbehandlungstechnologien, die in der modernen Fertigung zur Verfügung stehen.
Verbesserung der Haftung mit Plasmatreat

Die Openair-Plasma®-Technologie von Plasmatreat ist eine weltweit bewährte Lösung zur Verbesserung der Haftung in Fertigungsprozessen, in denen herkömmliche Vorbehandlungen an ihre Grenzen stoßen. Das Prinzip basiert auf der Erzeugung eines Atmosphärendruck-Plasmastrahls unter Verwendung von Elektrizität und Druckluft. Wenn dieses Plasma auf eine Oberfläche gerichtet wird, entfernt es organische Verunreinigungen, bricht molekulare Bindungen in schwachen Grenzschichten und führt neue polare funktionelle Gruppen ein, die die Oberflächenenergie deutlich erhöhen. Das Ergebnis ist eine mikroskopisch saubere, hoch benetzbare und chemisch aktive Oberfläche – ideale Bedingungen für eine starke und dauerhafte Verklebung, Lackierung, Beschichtung oder Versiegelung.
Die Vorteile von Openair-Plasma® gehen weit über herkömmliche Methoden wie Lösungsmittelreinigung oder Koronabehandlung hinaus. Es handelt sich um ein trockenes, berührungsloses und selektives Verfahren, das direkt in Produktionslinien integriert werden kann, ohne das Grundmaterial zu verändern oder Nachreinigungsschritte zu erfordern. Die Technologie funktioniert auf einer Vielzahl von Substraten – Kunststoffen, Metallen, Glas, Verbundwerkstoffen und Textilien – und kann komplexe Geometrien oder empfindliche Komponenten präzise behandeln. Damit eignet sie sich ideal für die Automobilherstellung (z. B. zuverlässige Lackhaftung auf Stoßstangen oder Verklebung von Scheinwerfergehäusen), der Medizintechnik (z. B. Aktivierung von Gerätegehäusen oder Schläuchen für die Klebeversiegelung) und der Elektronikfertigung (z. B. verbessertes Vergießen, konforme Beschichtung oder Verkapselung). In all diesen Branchen sorgt Openair-Plasma® für konsistente, wiederholbare Haftungsergebnisse, selbst auf anspruchsvollen Materialien mit niedriger Energie wie Polypropylen oder PTFE.
Die Entscheidung für Plasmatreat bedeutet eine Partnerschaft mit einem Marktführer, der fundiertes Prozess-Know-how mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung verbindet. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Konzeption, Erprobung und Integration von Plasma-Vorbehandlungssystemen inline und gewährleistet so hohe Effizienz und minimale Ausfallzeiten. Über die Leistungsfähigkeit hinaus bietet Plasma auch klare Nachhaltigkeitsvorteile: Es macht chemische Grundierungen oder Lösungsmittel überflüssig, reduziert Abfall und senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu thermischen oder chemischen Verfahren. Dies hilft Herstellern nicht nur, strengere Umweltvorschriften zu erfüllen, sondern senkt auch die Kosten und vereinfacht die Logistik.
Sicherstellung der Haftqualität
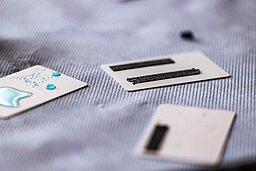
In der industriellen Fertigung ist die Messung und Dokumentation der Haftungsqualität unerlässlich, um die Prozesssicherheit und die langfristige Produktleistung zu gewährleisten. Da die Haftung in hohem Maße von der Oberflächenbeschaffenheit abhängt, bilden objektive Prüfverfahren und eine konsistente Überwachung das Rückgrat der Qualitätssicherung. Das am häufigsten verwendete Diagnosewerkzeug ist die Kontaktwinkelmessung, mit der bewertet wird, wie ein Flüssigkeitstropfen mit einer Oberfläche interagiert. Ein kleiner Kontaktwinkel weist auf eine starke Benetzbarkeit und hohe Oberflächenenergie hin – Bedingungen, die eine robuste Haftung begünstigen. Ausgefeiltere Ansätze berechnen die Oberflächenfreie Energie (SFE) und liefern numerische Kriterien, mit denen die Effizienz der Vorbehandlung validiert und eine gleichbleibende Produktionsqualität gewährleistet werden kann.
Über die Oberflächencharakterisierung hinaus quantifiziert die mechanische Prüfung die tatsächliche Festigkeit der Verbindung. Der Schälversuch misst die Widerstandsfähigkeit gegen Schälkräfte, was insbesondere für Folien, Filme oder flexible Substrate relevant ist. Der Zugtest ermittelt die Zugkraft, die erforderlich ist, um verbundene Komponenten voneinander zu trennen, während der Scherfestigkeitstest bewertet, wie gut eine Verbindung Kräften widersteht, die parallel zur Klebefuge wirken – und damit viele reale Belastungsbedingungen realistisch simuliert. Zusammen ergeben diese Tests ein vollständiges Bild der Haftungsleistung verschiedener Materialien und Verbindungsmethoden.
Um eine hohe Prozesskonsistenz zu gewährleisten, müssen alle Messungen systematisch dokumentiert und in die Qualitätskontrollabläufe integriert werden. Parameter wie Vorbehandlungsintensität, Klebstofftyp, Aushärtungsbedingungen und Testergebnisse sollten für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit miteinander verknüpft werden. In der modernen Fertigung kommen zunehmend Inline-Messsysteme zum Einsatz, die eine automatisierte Prozessüberwachung und sofortiges Feedback während der Produktion ermöglichen. Durch die direkte Erfassung von Daten aus der Fertigungslinie – wie z. B. Veränderungen der Oberflächenenergie oder der Haftfestigkeit – können Unternehmen Abweichungen verhindern, bevor sie zu Fehlern führen.
Bei Plasmatreat werden solche Analyse- und Validierungsfähigkeiten durch fortschrittliche Einrichtungen wie die Plasmatreat Academy unterstützt, wo Materialien, Prozessparameter und Haftungsprüfungen unter realen Produktionsbedingungen bewertet werden. Diese Integration von Messung, Dokumentation und Automatisierung sorgt dafür, dass die Haftung von einem variablen Faktor zu einem messbaren, zertifizierbaren Element der modernen industriellen Qualitätssicherung wird.
Was sind die häufigsten Ursachen für das Versagen von Klebeverbindungen in industriellen Prozessen?
Haftungsfehler sind in der Regel auf eine mangelhafte Oberflächenvorbereitung, Verunreinigungen oder inkompatible Materialien zurückzuführen. Ölrückstände, Trennmittel, Oxidationsschichten oder Feuchtigkeit können den molekularen Kontakt zwischen Klebstoff und Untergrund blockieren. Uneinheitliche Aushärtungsbedingungen, eine falsche Klebstoffauswahl oder mechanische Belastungen, die über die Auslegungsgrenzen hinausgehen, können ebenfalls zu vorzeitigem Versagen führen. Eine effektive Reinigung, Aktivierung und Prozesskontrolle sind daher für eine dauerhafte Haftung von entscheidender Bedeutung.
Welche Rolle spielt die Oberflächenrauheit für die Haftfähigkeit, und ist eine höhere Rauheit immer besser?
Die Oberflächenrauheit kann die Haftung verbessern, indem sie die mechanische Verriegelung fördert – jedoch nur, wenn der Klebstoff die Oberfläche vollständig benetzt. Übermäßige oder unregelmäßige Rauheit kann Luft oder Verunreinigungen einschließen und die tatsächliche Kontaktfläche verringern. Die optimale Rauheit hängt vom Material und der Viskosität des Klebstoffs ab. In vielen Fällen führt eine kontrollierte Mikrorauheit in Kombination mit einer hohen Oberflächenenergie zu den stärksten und beständigsten Verbindungen.
Wie beeinflusst die Oberflächenenergie eines Substrats die Wahl des Klebstoffs oder des Beschichtungsverfahrens?
Die Oberflächenenergie bestimmt, wie leicht sich ein flüssiger Klebstoff oder eine Beschichtung auf einer Oberfläche verteilen lässt. Hochenergetische Materialien (wie Metalle oder Glas) unterstützen eine hervorragende Benetzung und Haftung, während niedrigenergetische Polymere (wie PP, PE oder PTFE) der Haftung widerstehen. Bei diesen Materialien muss die Wahl des Verfahrens eine Oberflächenbehandlung umfassen – beispielsweise Plasma-, Corona- oder Flammenaktivierung –, um die Oberflächenenergie zu erhöhen und eine zuverlässige Benetzung und Haftung zu ermöglichen.
Wie können Ingenieure die Messung und Überwachung der Haftung in Massenproduktionslinien integrieren?
In automatisierten Umgebungen kann die Haftungsqualität mithilfe von Inline-Systemen überwacht werden, die die Oberflächenenergie oder den Kontaktwinkel direkt an der Produktionslinie messen. Diese Sensoren liefern Echtzeit-Feedback zur Oberflächenbeschaffenheit vor dem Verkleben oder Beschichten. In Kombination mit routinemäßigen mechanischen Tests (z. B. Abzieh- oder Zugproben) und digitaler Prozessdokumentation machen solche Systeme die Haftung zu einer messbaren und kontrollierbaren Variable in der Großserienfertigung.
Können Oberflächenbehandlungen (wie Plasma, Flamme, Corona) Grundierungen vollständig ersetzen, oder gibt es Fälle, in denen Grundierungen nach wie vor unverzichtbar sind?
Moderne Plasma- und Koronabehandlungen machen chemische Grundierungen oft überflüssig, da sie die Oberfläche effizienter und nachhaltiger reinigen und aktivieren. Grundierungen können jedoch weiterhin unerlässlich sein, wenn bestimmte chemische Kopplungen, Korrosionsschutz oder ästhetische Funktionen erforderlich sind. Der optimale Ansatz hängt vom Substrat, der Klebstoffchemie und der Anwendungsumgebung ab – daher bleibt eine Prozessvalidierung weiterhin erforderlich.
Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich beim Verkleben unterschiedlicher Materialien (z. B. Kunststoff mit Metall)?
Das Verbinden unterschiedlicher Materialien bringt Herausforderungen mit sich, die sich aus Unterschieden in der Oberflächenenergie, der Wärmeausdehnung und der Elastizität ergeben. Kunststoffe können sich stärker ausdehnen oder zusammenziehen als Metalle, wodurch bei Temperaturänderungen Spannungen an der Grenzfläche entstehen. Darüber hinaus erfordern unpolare Polymere häufig eine Oberflächenaktivierung, um eine chemische Kompatibilität mit Metallsubstraten zu erreichen. Bei der Auswahl des Klebstoffs müssen Flexibilität, Aushärtungsverhalten und langfristige Umweltstabilität berücksichtigt werden.
Wie wichtig ist die Gestaltung der Klebeverbindung (Spalt, Dicke, Geometrie) für eine starke Haftung?
Die Konstruktion der Verbindung ist entscheidend. Die richtige Spaltgröße gewährleistet eine vollständige Benetzung ohne Hohlräume; die Klebstoffdicke muss ein Gleichgewicht zwischen Spannungsverteilung und Lastaufnahme herstellen; und die Geometrie beeinflusst, wie Kräfte auf die Klebeverbindung wirken. Konstruktionen, die Schäl- oder Spaltkräfte vermeiden und Scher- oder Druckbelastungen begünstigen, bieten in der Regel eine höhere Haltbarkeit. Eine gute Konstruktion der Verbindung ist ebenso wichtig wie eine gute Vorbereitung der Oberfläche.
Was sind die Einschränkungen der Klebeverbindung als Fügeverfahren im Vergleich zur mechanischen Befestigung oder zum Schweißen?
Klebeverbindungen ermöglichen zwar eine leichte, gleichmäßige Spannungsverteilung und die Verwendung verschiedener Materialien, haben jedoch auch ihre Grenzen. Klebeverbindungen erfordern eine Oberflächenvorbereitung und eine Aushärtungszeit und sind im Allgemeinen weniger widerstandsfähig gegenüber hohen Dauertemperaturen als Schweiß- oder Schraubverbindungen. Außerdem lassen sie sich schwerer demontieren oder zerstörungsfrei prüfen. Bei richtiger Konstruktion bieten Klebeverbindungen jedoch oft eine überlegene Ästhetik, Korrosionsbeständigkeit und Ermüdungsfestigkeit.

